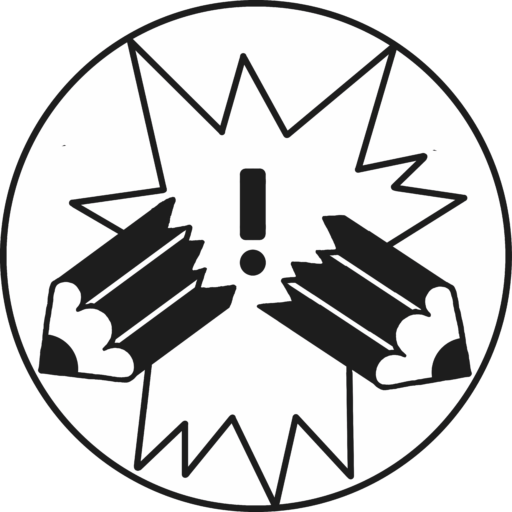Offener Brief:
Rassismuskritische Forderungen
an die Pädagogischen Hochschulen
gerichtet an:
Pädagogische Hochschule Bern Pädagogische Hochschule Wallis Pädagogische Hochschule Graubünden Pädagogische Hochschule Freiburg Pädagogische Hochschule Thurgau Pädagogische Hochschule Luzern Pädagogische Hochschule Zug Pädagogische Hochschule Schwyz Pädagogische Hochschule Schaffhausen Pädagogische Hochschule Zürich Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule St.Gallen
Unterschriften
Wir fordern:
- Die Pädagogischen Hochschulen sind mitverantwortlich dafür, dass das Thema Rassismus umfassend in das Curriculum integriert wird. Rassismus soll im Rahmen von Pflichtmodulen im Grundstudium ein obligatorisches Thema sein. Dabei muss race als Strukturkategorie intersektional mitgedacht werden.
- Rassismuskritische Handlungsansätze für die Praxis sollen im Rahmen des Curriculums explizit aufgezeigt werden.
- Die Geschichte der Industrialisierung und des (Post-)Kolonialismus muss gelehrt und in den Kontext der Kolonialgeschichte gesetzt werden.
- Das Verständnis für Intersektionalität soll explizit gefördert werden, damit sich dieser Ansatz auch in der Praxis der Pädagogik niederschlägt.
- Das Erkennen und Thematisieren von Rassismus muss gelehrt werden. In Reflexionen sollen Rassismuserfahrungen wie auch unbeabsichtigtes rassistisches Handeln einbezogen werden.
- Es soll ein rassismuskritischer Sprachleitfaden erarbeitet werden, damit alle Studierenden wie auch die Dozierenden und Mitarbeitenden eine rassismuskritische Sprache nutzen.
- In Schulunterlagen und Lehrmitteln soll nicht nur die eurozentrische Perspektive dargestellt, sondern es müssen geschichtliche Inhalte aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, um eine kritische und differenzierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema zu ermöglichen.
- Die Curricula sollen regelmässig und systematisch auf rassistische Inhalte überprüft und angepasst werden.
- Auf rassistische und diskriminierende Inhalte von Erzählungen, Illustrationen und Darstellungen muss sowohl in Lehrveranstaltungen wie auch im Schulunterricht verzichtet werden. Sollen dennoch entsprechende Texte/Abbildungen diskutiert werden, braucht es einen Content Note oder eine Triggerwarnung und die Inhalte müssen in den geschichtlich-rassistischen Kontext gesetzt sowie mit Quellenangaben versehen werden.
In allen Modulen dominieren eurozentrische Perspektiven und Narrative. Die Lehrveranstaltungen und ein Grossteil der Dozierenden problematisieren diese Tatsache nicht oder kaum. Rassismus wird weder in den Fachdidaktikmodulen noch im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung bennant und problematisiert. Es liegt im Ermessen der Dozierenden, ob sie rassistische Inhalte zeigen und wie sie diese einbetten. Auch in Bezug auf Sprache gibt es keine Richtlinien: Die PH Zürich hat zwar einen Leitfaden für einen geschlechtergerechten sprachlichen Auftritt, aber keinen rassismuskritischen Sprachleitfaden.
Auch im Lehrplan 21, welcher die zu vermittelnden Kompetenzen für die Volksschule vorgibt, wird der reflektierte Umgang mit Rassismus und Rassismuskritik nicht eingefordert. Der Begriff «Rassismus» oder Variationen davon kommen in keiner Weise vor. Diese Lücke im Lehrplan 21 darf nicht als Legitimation für das Fehlen der Rassismuskritik im Curiculum der PH Zürich dienen.
- Die Pädagogischen Hochschulen sollen die Auseinandersetzung mit dem Thema (Anti-)Rassismus bei den Dozierenden fördern.
- Für die Dozierenden braucht es obligatorische Weiterbildungsangebote, in denen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema (Anti-)Rassismus gewährleistet ist.
- Neben den Dozierenden müssen auch die Fachleute der Mentorate und der Praxisausbildung eine Rassismussensibilität mitbringen, um eine entsprechend rassismuskritische Begleitung der Studierenden zu ermöglichen.
Die PH Zürich fördert die Auseinandersetzung von Dozierenden mit dem Thema Antirassismus kaum. Das Team der Kommission Diversity_Gender hat am 28.06.2021 einen eintägigen Workshop zum Thema Rassismus besucht (PHZH, Aktionsplan 2017-2021), eine breite Sensibilisierung der Angestellten an der PH Zürich findet aber nicht statt. Bestehende Angebote wie z.B. Workshops vom Verein Diversum werden von der PH Zürich zur internen Weiterbildung nicht in Anspruch genommen. Die fehlende Auseinandersetzung mit dem Thema (Anti-)Rassismus zeigt sich nicht nur bei Dozierenden, sondern auch bei Mentor*innen und Praxislehrpersonen, die von der PH Zürich angestellt sind. Da die meisten Lehrtätigen der PH Zürich nicht oder kaum rassismuskritisch weitergebildet werden, reproduzieren sie in ihren Lehrveranstaltungen Rassismus. Wenn rassismuskritische Inhalte an der PH Zürich vermittelt oder diskutiert werden, dann nur auf Initiative von Einzelpersonen.
- Diversitätsbeauftragte Personen sollen über Fachwissen zum Thema (Anti-)Rassismus und weiteren Diskriminierungsformen verfügen und ein machtkritisches Verständnis vorweisen können.
- Die diversitätsbeauftragten Personen müssen entsprechend geschult werden, damit sie rassismuskritisch handeln können. Zweigeschlechtergleichstellungswissen reicht nicht aus.
- Die Kompetenzen der diversitätsbeauftragten Personen müssen gestärkt werden, damit sie aktiv in der Hochschule mitwirken können. So könnten sie niederschwellig Dozierenden als Ansprechpersonen dienen und auch Studierenden zur Seite stehen.
- Ideal wäre es, wenn mindestens eine Person, die selbst von Rassismus betroffen ist, beauftragt würde, um so der notwendigen diversen Repräsentation gerecht zu werden.
Seit 2003 gibt es an der PH Zürich die Kommission Diversity_Gender. Sie hat einen sehr kleinen Tätigkeitsbereich und organisiert jährlich ein paar wenige Veranstaltungen. Die Kommission thematisiert Rassismus jedoch kaum. Ausserdem verfügen nicht alle Mitglieder der Kommission über ausreichendes Fachwissen. Die Kommission Diversity_Gender hat zu wenig Ressourcen, um einer Funktion als Anlaufstelle gerecht zu werden (PHZH, Tätigkeiten der Kommission Diversity_Gender, 2004-2021).
- Wir fordern, dass der Zugang für Menschen, die einen in der Schweiz nicht anerkannten Abschluss im sekundären oder tertiären Bildungsbereich haben, vereinfacht wird.
- Im Sinne eines Abbaus von Ausschlussmechanismen muss ein angemessener Nachteilsausgleich möglich sein.
- Situationsgebundene Erlasse von Studiengebühren sind notwendig.
- Die Anerkennung und Anrechnung von getätigten Aus- und Weiterbildungen im Ausland erachten wir als wichtig.
Die Zugangspolitik der PH Zürich ist derzeit diskriminierend und mit grossen Hürden verbunden. Für die Anerkennung ausländischer Lehrdiplome ist die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zuständig. Wenn die EDK von wesentlichen Ausbildungsunterschieden ausgeht, erfolgt die Anerkennung erst nach erfolgreichem Absolvieren von Ausgleichsmassnahmen. Lehrpersonen mit ausländischem Lehrdiplom, die über einen Entscheid der EDK zu solchen Ausgleichsmassnahmen verfügen, können die fehlenden Ausbildungsteile an der PH Zürich erfüllen und so die geforderten ECTS-Punkte erhalten. Die Kosten wurden von der EDK festgelegt. Sie betragen gegenwärtig 450 Franken pro ECTS-Punkt (PHZH, Zulassung ausländischer Diplome. 2023). Auch die Gleichwertigkeitsüberprüfung eines Ausbildungsabschlusses ist teuer: Bei Diplomen aus einem EU/EFTA-Staat kostet es 800 CHF und bei solchen aus einem Drittstaat 1000 CHF (EDK, Diplomanerkennung Ausländische Diplome. 2023).
Wer über keine Maturität verfügt, kann sich mit einem Kurs auf die Prüfung vorbereiten. Der Besuch eines Vorkurses ist für Studierende, die seit mindestens zwei Jahren (24 Monate) ihren Wohnsitz (Steuerdomizil) im Kanton Zürich haben, kostenlos. Alle anderen Bewerber*innen bezahlen für den Jahres-Vorkurs (Vorkurse 1 und 2) 14’700 Franken und für den Kompakt-Vorkurs (Vorkurs 3) 10’850 Franken (PHZH, Vorbereitungskurse Kosten. 2023).
- Die Pädagogischen Hochschulen sollen sich rassismuskritisch positionieren. Dies bedingt, die eigenen Strukturen entsprechend zu überdenken und fortan rassismuskritische Ansätze zu verankern.
- Institutioneller Rassismus muss in den Strukturen der Pädagogischen Hochschulen und der Praxis kritisch beleuchtet werden. So sollen beispielsweise die Zugänge, die Vertretung und Repräsentation in der Pädagogik wie auch die Geschichte der Pädagogik kritisch hinterfragt werden.
- Es braucht die Entwicklung geeigneter Tools, um der rassistischen Diskriminierung im institutionellen Kontext entgegenzuwirken.
- Die Pädagogischen Hochschulen sollen sich zu aktuellen sozialpolitischen Ereignissen rassismuskritisch positionieren und solche in den Vorlesungen thematisieren.
- Rassismusbetroffene Dozierende müssen beim Einstellungsverfahren berücksichtigt und in Schlüsselpositionen an der Hochschule vertreten sein.
- Die Diversity Politik gilt es kritisch zu hinterfragen und zu optimieren, um Scheindiversität zu vermeiden. Dabei ist es notwendig, eine intersektionale Perspektive einzunehmen.
- Die psychologischen und soziokulturellen Auswirkungen von Rassismuserfahrungen in der Bildung brauchen dringend Aufmerksamkeit. Es muss darüber geforscht werden, denn die Datenlage in der Schweiz bzgl. der Auswirkungen von Rassismuserfahrungen ist mangelhaft.
Die Diversity Policy der PH Zürich wurde 2014 formuliert und seither nicht mehr überarbeitet. Sie ist sehr kurzgefasst und Rassismus als Diskriminierungsmechanismus oder antirassistische Massnahmen werden nicht benannt (PHZH, Diversity Policy. 2014). Auf der Webseite der Kommission werden keine Link-Empfehlungen zum Thema (Anti-)Rassismus veröffentlicht (PHZH, Kommission Diversity_Gender. 2023). In der Strategie 2022-2025 schreibt die Hochschulleitung: «Schwerpunkte setzt die PH Zürich bei den Themen Chancengerechtigkeit.» Die Bedeutung davon wird nicht ausgeführt und Diskriminierungsmechanismen werden nicht benannt (PHZH, Strategie 2022–2025).
- Die Pädagogischen Hochschulen sollen gewährleisten, dass Anlaufstellen für rassismusbetroffene Personen zur Verfügung gestellt werden.
- Rassimusbetroffene Personen müssen die Möglichkeit haben, diskriminierende Vorfälle bei einer unabhängigen Beschwerdestelle zu melden.
- Die Beschwerdestelle soll einheitliche Abläufe haben, um bei diskriminierenden Vorfällen adäquat zu reagieren.
- Rassismusvorfälle müssen langfristig dokumentiert werden.
- Rassismusbetroffene Personen brauchen Zugang zu einer psychologischen Beratungsstelle.
- Die psychologischen Beratungsstellen müssen den Anspruch haben, rassismuskritischen Ansätzen zu unterliegen, damit eine kontextgerechte Beratung gewährleistet werden kann.
In ihrer «Strategie 2022–2025» formuliert die PH Zürich ihr Selbstverständnis und fünf Ambitionen in unterschiedlichen Wirkungsfeldern. So wird für das Ziel «Bildung, Schule und Unterricht mitgestalten» Folgendes formuliert: «Die PH Zürich entwickelt innovative Formen des Lehrens und Lernens für alle Bildungsstufen und wirkt damit an den aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft, Wissenschaft und Bildungspraxis mit. Sie setzt sich dabei insbesondere auch mit digitaler Transformation, nachhaltiger Entwicklung und Chancengerechtigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen auseinander und fördert entsprechende Kompetenzen und Strukturen.» (PHZH, Strategie 2022 –2025)
Eine vertiefte Auseinandersetzung und daraus resultierende Strukturen mit dem Thema Chancengerechtigkeit, welches im zweiten Ziel sogar als Schwerpunkt formuliert wird, ist bis anhin an der PH Zürich nicht spürbar und der Weg hin zu einer rassismussensiblen Institution wurde noch nicht eingeschlagen. Auch das Ziel 4 «Berufliche Entwicklungen ermöglichen» mit seiner Ausführung «Die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels nimmt die PH Zürich dabei genauso ernst wie ein chancengerechtes internes Umfeld und die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf» bleibt ohne eine institutionell verankerte Strategie zur Transformation hin zu einer rassismussensiblen Institution eine reine Worthülse.
Wenn die PH Zürich ihre eigens formulierte Strategie also nicht nur als Floskel verstehen möchte, müssen den Worten Taten folgen. Wir erwarten eine Stellungnahme, in der die PH Zürich zeigt, wann und welche Schritte sie hin zu einer rassismussensiblen Organisation macht und dass sie sich in einen vertieften Prozess mit ihren eigenen Strukturen begibt. Mit diesem offenen Brief möchten wir an die Hochschulleitung appellieren, auf diese Forderungen einzugehen und sie im Sinne ihrer «Strategie 2022-2025» im gesetzten Zeitrahmen umzusetzen. Denn es bleibt offen, welche Zukunft die PH Zürich mit ihrem Claim «Gemeinsam bilden. Zukunft gestalten» meint.
Kollektiv Kritische Lehrpersonen
© Copyright 2023 by Kollektiv Kritische Lehrpersonen